Einkaufslexikon
Lieferkettengesetz: Definition, Compliance und Auswirkungen auf die Beschaffung
November 19, 2025
Das Lieferkettengesetz verpflichtet deutsche Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards in ihren globalen Lieferketten. Diese gesetzliche Regelung hat weitreichende Auswirkungen auf die Beschaffungsstrategie und erfordert neue Compliance-Prozesse. Erfahren Sie im Folgenden, was das Lieferkettengesetz bedeutet, welche Methoden zur Umsetzung existieren und wie sich aktuelle Entwicklungen auf die Beschaffung auswirken.
Key Facts
- Gilt seit 2023 für Unternehmen mit über 3.000 Beschäftigten, ab 2024 für solche mit über 1.000
- Umfasst Sorgfaltspflichten für Menschenrechte und Umweltschutz in der gesamten Lieferkette
- Bußgelder bis zu 2% des Jahresumsatzes bei Verstößen möglich
- Erfordert Risikoanalysen, Präventionsmaßnahmen und Beschwerdemechanismen
- Beeinflusst Lieferantenauswahl und Vertragsgestaltung erheblich
Inhalt
Definition: Lieferkettengesetz – Bedeutung und Kernaussagen
Das deutsche Lieferkettengesetz regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards entlang globaler Wertschöpfungsketten.
Gesetzliche Grundlagen und Anwendungsbereich
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) trat am 1. Januar 2023 in Kraft und betrifft zunächst Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten. Ab 2024 gilt es auch für Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern. Die Regelung umfasst sowohl den eigenen Geschäftsbereich als auch unmittelbare und mittelbare Zulieferer.
Kernpflichten für Unternehmen
Betroffene Unternehmen müssen Sorgfaltspflichten erfüllen, die sich in mehrere Bereiche gliedern:
- Einrichtung eines Risikomanagements
- Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen
- Implementierung von Präventions- und Abhilfemaßnahmen
- Etablierung von Beschwerdemechanismen
- Dokumentation und Berichterstattung
Bedeutung des Lieferkettengesetzes im Einkauf
Für die Beschaffungsstrategie bedeutet das Gesetz eine fundamentale Neuausrichtung. Die Eignungsprüfung von Lieferanten muss um Nachhaltigkeitskriterien erweitert werden, und Stakeholder-Management gewinnt an strategischer Bedeutung.
Methoden und Vorgehensweisen
Die praktische Umsetzung des Lieferkettengesetzes erfordert strukturierte Methoden und systematische Vorgehensweisen zur Compliance-Sicherstellung.
Risikoanalyse und Due Diligence
Unternehmen müssen regelmäßige Risikoanalysen durchführen, um potenzielle Menschenrechts- und Umweltverletzungen zu identifizieren. Diese umfassen die Bewertung von Länderrisiken, Branchenspezifika und Lieferantenstrukturen. Die Marktanalyse wird um Nachhaltigkeitsaspekte erweitert.
Lieferantenbewertung und -entwicklung
Die Implementierung erfordert neue Bewertungskriterien für Lieferanten:
- Zertifizierungen und Compliance-Nachweise
- Audits vor Ort und Dokumentenprüfungen
- Kontinuierliche Überwachung und Monitoring
- Entwicklungsprogramme für kritische Lieferanten
Vertragliche Absicherung
Verträge müssen entsprechende Klauseln enthalten, die Lieferanten zur Einhaltung der Standards verpflichten. Das Reklamationsmanagement wird um Compliance-Verstöße erweitert, und Claim-Management gewinnt an Bedeutung.

Tacto Intelligence
Vereint tiefes Einkaufswissen mit den leistungsstärksten KI-Agenten für einen starken Einkauf.
Kennzahlen zur Steuerung des Lieferkettengesetzes
Effektive Kennzahlen ermöglichen die Messung und Steuerung der Compliance-Performance im Rahmen des Lieferkettengesetzes.
Compliance-Kennzahlen
Zentrale KPIs zur Überwachung der Gesetzeskonformität umfassen die Anzahl durchgeführter Risikoanalysen, den Anteil zertifizierter Lieferanten und die Reaktionszeit auf Compliance-Verstöße. Diese Metriken unterstützen das Benchmarking im Einkauf und ermöglichen kontinuierliche Verbesserungen.
Lieferanten-Performance-Indikatoren
Wichtige Kennzahlen zur Lieferantenbewertung beinhalten:
- Compliance-Rate der Lieferanten (%)
- Anzahl identifizierter Risiken pro Lieferant
- Durchschnittliche Reaktionszeit auf Audit-Findings
- Anteil der Lieferanten mit gültigen Nachhaltigkeitszertifikaten
Finanzielle und operative Kennzahlen
Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden durch Kennzahlen wie Compliance-Kosten pro Lieferant, Audit-Kosten als Anteil am Einkaufsvolumen und Cost Avoidance durch präventive Maßnahmen gemessen. Das Return on Investment von Compliance-Investitionen wird zunehmend wichtiger.
Risikofaktoren und Kontrollen beim Lieferkettengesetz
Die Nichteinhaltung des Lieferkettengesetzes birgt erhebliche rechtliche, finanzielle und reputative Risiken für Unternehmen.
Rechtliche und finanzielle Risiken
Verstöße gegen das Lieferkettengesetz können zu Bußgeldern von bis zu 2% des Jahresumsatzes führen. Zusätzlich drohen Ausschlüsse von öffentlichen Aufträgen und zivilrechtliche Haftungsrisiken. Die Richtlinien-Compliance im Einkauf wird zur kritischen Erfolgsgröße.
Operative Herausforderungen
Die praktische Umsetzung bringt verschiedene operative Risiken mit sich:
- Unvollständige Transparenz in komplexen Lieferketten
- Mangelnde Kooperation von Lieferanten
- Ressourcenengpässe bei der Implementierung
- Schwierigkeiten bei der Datenerhebung und -validierung
Reputationsrisiken und Marktauswirkungen
Compliance-Verstöße können erhebliche Reputationsschäden verursachen und Kundenbeziehungen gefährden. Das Supply Chain Visibility wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, während Versorgungssicherheit neu definiert werden muss.
Praxisbeispiel
Ein deutscher Automobilhersteller implementiert das Lieferkettengesetz durch systematische Risikoanalysen seiner 2.500 direkten Lieferanten. Das Unternehmen führt jährliche Audits bei kritischen Lieferanten durch und entwickelt ein digitales Dashboard zur kontinuierlichen Überwachung von Compliance-Kennzahlen. Bei einem Zulieferer in Südostasien werden Arbeitsrechtsverstöße identifiziert, woraufhin ein strukturiertes Entwicklungsprogramm eingeleitet wird.
- Risikoklassifizierung aller Lieferanten nach Länder- und Branchenrisiken
- Implementierung eines digitalen Beschwerdemechanismus
- Quartalsweise Berichterstattung an das Management
Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen
Das Lieferkettengesetz entwickelt sich kontinuierlich weiter und wird durch technologische Innovationen und regulatorische Änderungen geprägt.
Digitalisierung der Compliance-Prozesse
Moderne Technologien revolutionieren die Umsetzung des Lieferkettengesetzes. Künstliche Intelligenz ermöglicht automatisierte Risikoanalysen und kontinuierliches Monitoring. Die digitale Supply Chain bietet neue Möglichkeiten für Transparenz und Nachverfolgbarkeit.
Europäische Harmonisierung
Die EU-Richtlinie zur Corporate Sustainability Due Diligence wird die Anforderungen weiter verschärfen:
- Ausweitung auf kleinere Unternehmen
- Verschärfte Haftungsregelungen
- Harmonisierung der Standards europaweit
- Integration in die digitale Beschaffung
Auswirkungen auf Sourcing-Strategien
Unternehmen überdenken ihre Beschaffungsstrategien grundlegend. Nearshoring und Reshoring gewinnen an Bedeutung, während Supply Chain Resilience Management zur strategischen Priorität wird.
Fazit
Das Lieferkettengesetz stellt Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, bietet aber auch Chancen für nachhaltigere und resilientere Beschaffungsstrategien. Die erfolgreiche Umsetzung erfordert systematische Risikoanalysen, digitale Monitoring-Systeme und enge Zusammenarbeit mit Lieferanten. Unternehmen, die frühzeitig in Compliance-Strukturen investieren, können Wettbewerbsvorteile erzielen und gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.
FAQ
Was regelt das deutsche Lieferkettengesetz konkret?
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards in ihren Lieferketten. Es umfasst Sorgfaltspflichten wie Risikoanalysen, Präventionsmaßnahmen, Beschwerdemechanismen und regelmäßige Berichterstattung. Verstöße können Bußgelder bis zu 2% des Jahresumsatzes zur Folge haben.
Welche Unternehmen sind vom Lieferkettengesetz betroffen?
Seit 2023 gilt das Gesetz für Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten, ab 2024 für solche mit über 1.000 Mitarbeitern. Entscheidend ist die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland, wobei auch ausländische Unternehmen mit entsprechender Präsenz betroffen sein können.
Wie wirkt sich das Gesetz auf die Lieferantenauswahl aus?
Die Lieferantenauswahl muss um Nachhaltigkeitskriterien erweitert werden. Unternehmen müssen Due-Diligence-Prüfungen durchführen, Zertifizierungen verlangen und kontinuierliche Überwachung implementieren. Verträge benötigen entsprechende Compliance-Klauseln und Sanktionsmechanismen bei Verstößen.
Welche Kosten entstehen durch die Umsetzung des Lieferkettengesetzes?
Die Implementierungskosten variieren je nach Unternehmensgröße und Komplexität der Lieferkette. Typische Kostenfaktoren umfassen Personal für Compliance-Management, IT-Systeme für Monitoring, Audits und Zertifizierungen sowie mögliche Lieferantenwechsel. Langfristig können jedoch Risikominimierung und Effizienzgewinne die Investitionen rechtfertigen.

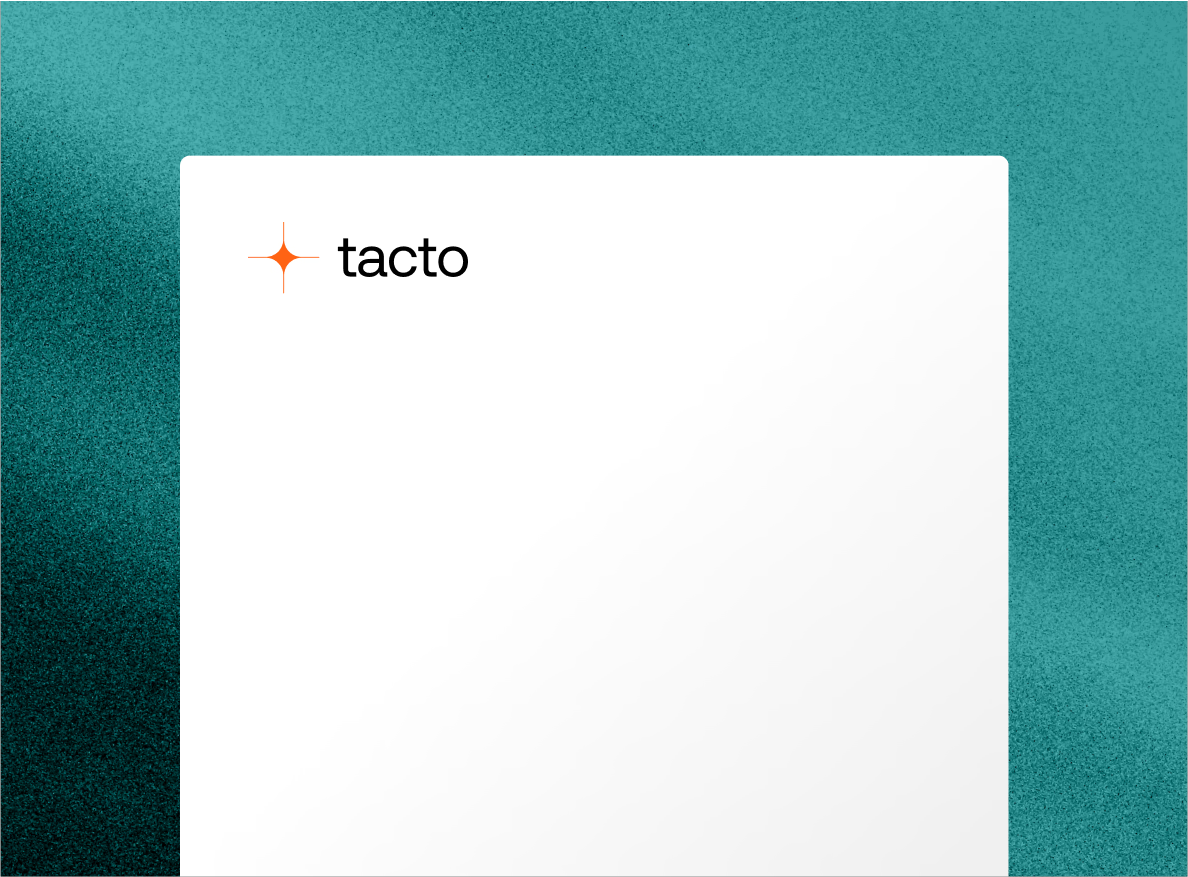
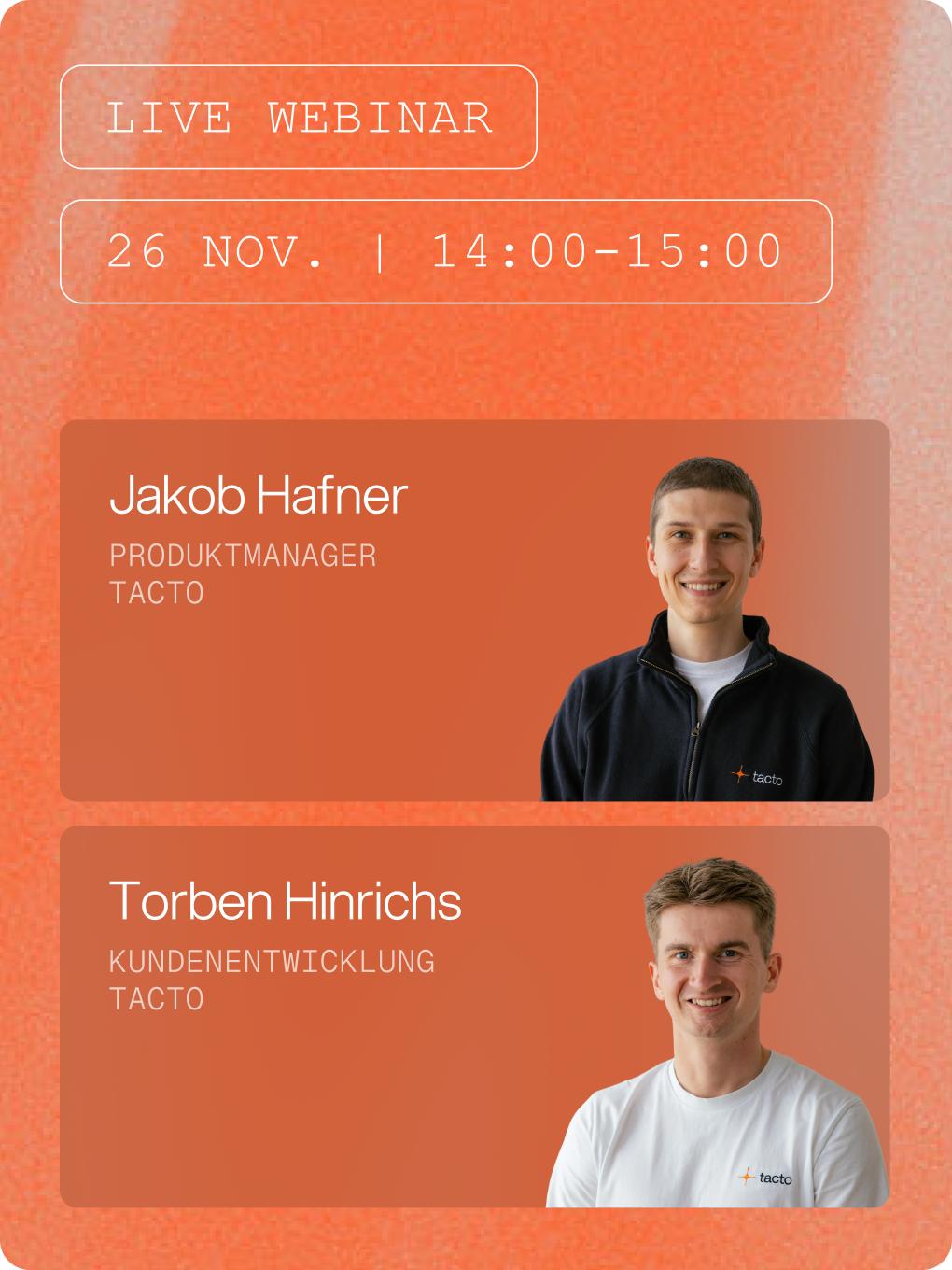
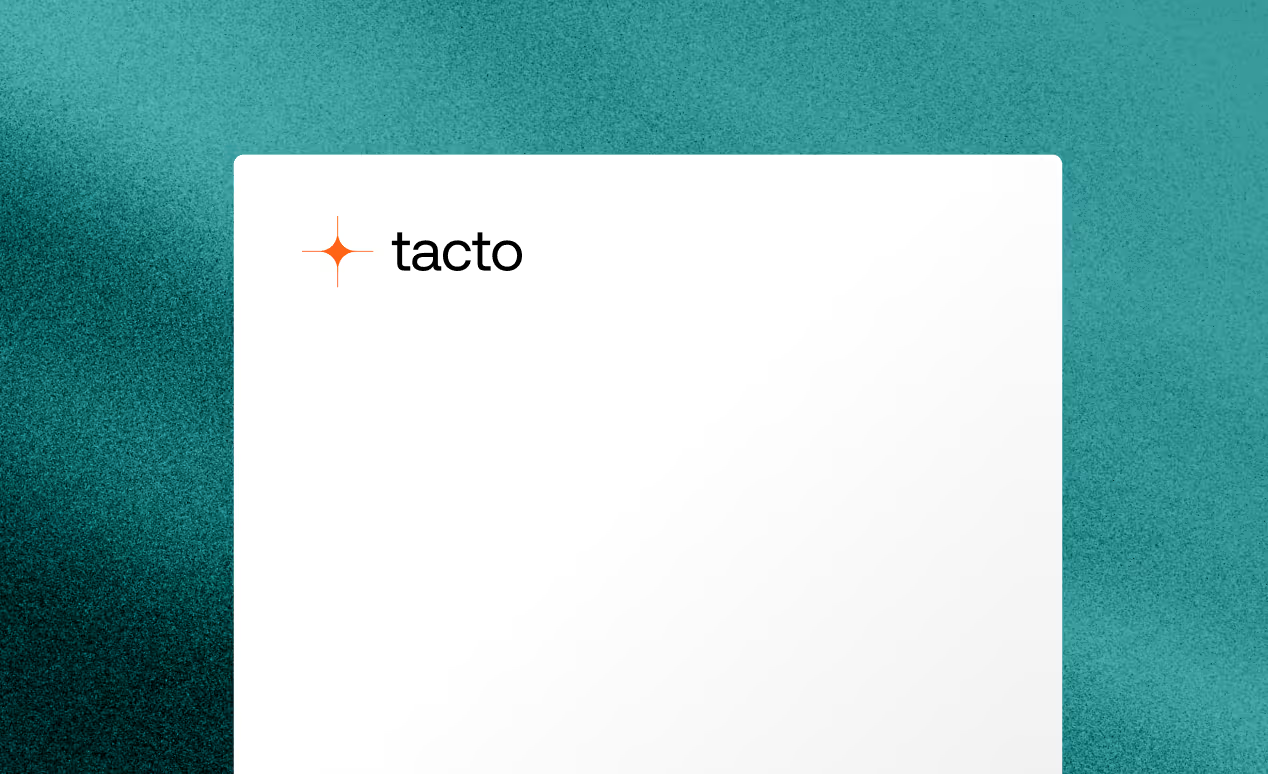


.png)
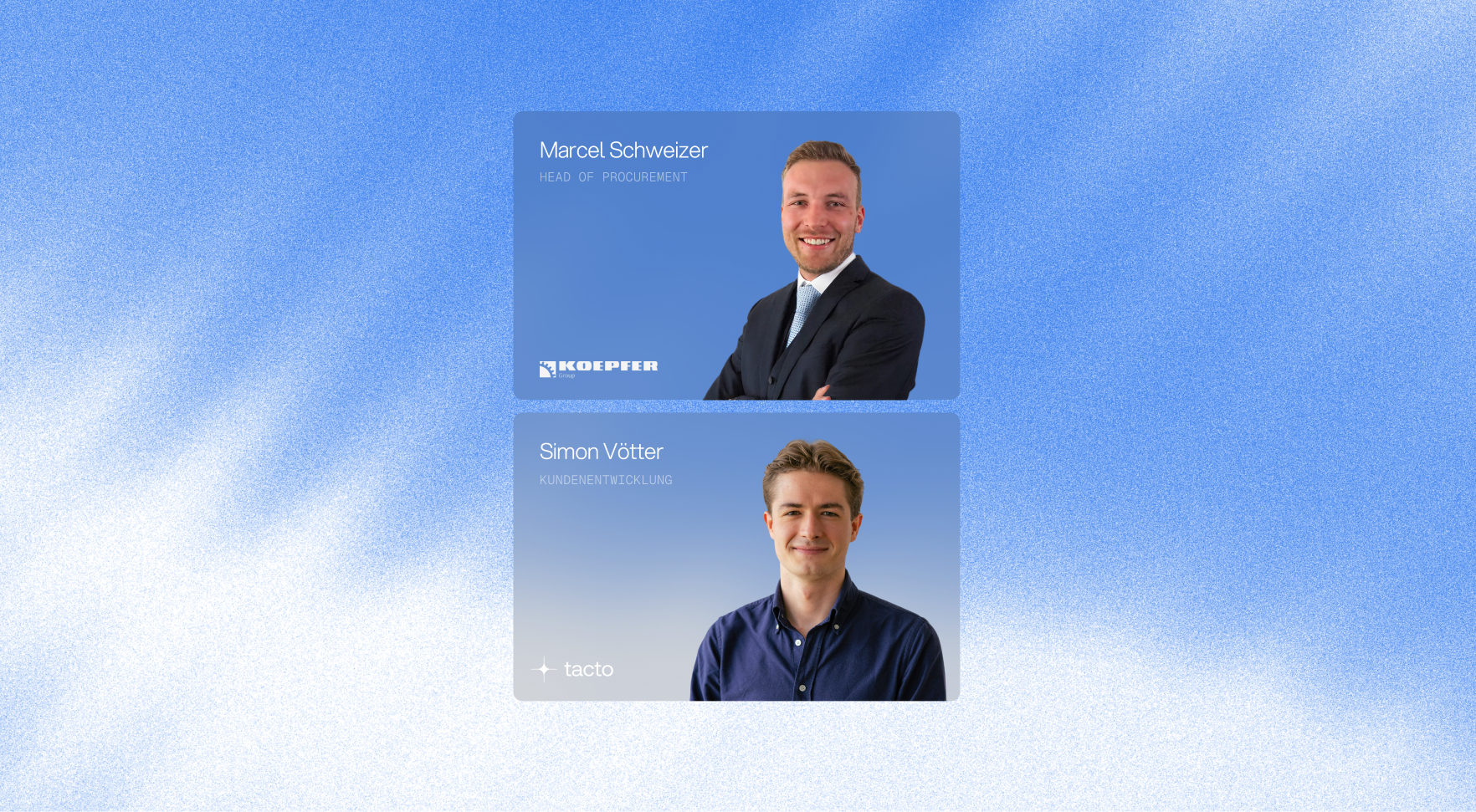


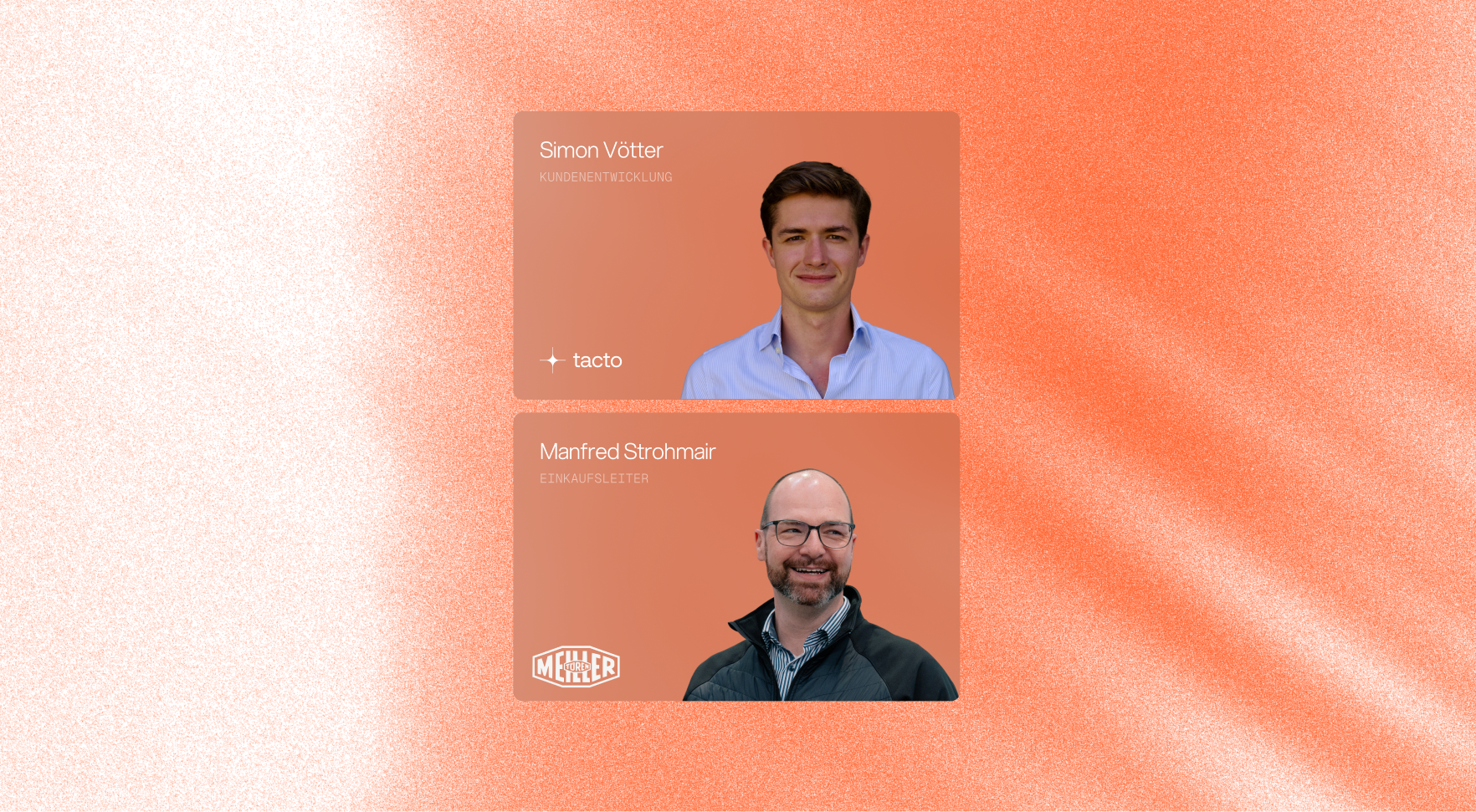
.png)
.png)
.png)
