Einkaufslexikon
Multiple Sourcing: Definition, Strategien und Anwendung im Einkauf
November 19, 2025
Multiple Sourcing bezeichnet eine Beschaffungsstrategie, bei der Unternehmen bewusst mehrere Lieferanten für dieselben Produkte oder Dienstleistungen einsetzen. Diese Diversifikation der Lieferantenbasis reduziert Abhängigkeiten und erhöht die Versorgungssicherheit. Erfahren Sie im Folgenden, was Multiple Sourcing ausmacht, welche Methoden zur Anwendung kommen und wie Sie diese Strategie erfolgreich implementieren.
Key Facts
- Verteilung des Beschaffungsvolumens auf mindestens zwei Lieferanten pro Materialgruppe
- Reduziert Lieferrisiken und stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Anbietern
- Erfordert höheren Koordinationsaufwand als Single Sourcing
- Ermöglicht Benchmarking zwischen verschiedenen Lieferanten
- Besonders relevant bei kritischen Materialien und strategischen Komponenten
Inhalt
Was ist Multiple Sourcing?
Multiple Sourcing ist eine strategische Herangehensweise in der Beschaffung, die auf Diversifikation und Risikostreuung setzt.
Grundprinzipien des Multiple Sourcing
Bei dieser Strategie werden Bestellvolumen bewusst auf mehrere qualifizierte Lieferanten aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach definierten Kriterien wie Kapazität, Qualität oder geografischer Lage.
- Mindestens zwei aktive Lieferanten pro Materialgruppe
- Regelmäßige Leistungsbewertung aller Partner
- Flexible Volumenverteilung je nach Marktlage
Multiple Sourcing vs. Single Sourcing
Im Gegensatz zu Single Sourcing verzichtet Multiple Sourcing auf die exklusive Partnerschaft mit einem Anbieter. Stattdessen wird bewusst Redundanz geschaffen, um Flexibilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Bedeutung von Multiple Sourcing im Einkauf
Diese Beschaffungsstrategie ist besonders wertvoll bei kritischen Materialien und in volatilen Märkten. Sie unterstützt die Versorgungssicherheit und ermöglicht kontinuierliche Marktbeobachtung durch direkten Lieferantenvergleich.
Vorgehen: So funktioniert Multiple Sourcing
Die erfolgreiche Umsetzung von Multiple Sourcing erfordert systematisches Vorgehen und klare Prozessstrukturen.
Lieferantenauswahl und -qualifikation
Der erste Schritt umfasst die Identifikation und Bewertung geeigneter Lieferanten. Dabei werden technische, kommerzielle und strategische Kriterien angewendet.
- Durchführung einer umfassenden Marktanalyse
- Definition von Abnahmekriterien und Qualitätsstandards
- Bewertung der Lieferantenkapazitäten und -stabilität
Volumenaufteilung und Allokationsstrategie
Die Verteilung des Beschaffungsvolumens erfolgt nach strategischen Gesichtspunkten. Typische Aufteilungsmodelle reichen von gleichmäßiger Verteilung bis hin zu gewichteten Allokationen basierend auf Leistungskennzahlen.
Kontinuierliches Lieferantenmanagement
Multiple Sourcing erfordert aktives Management aller Lieferantenbeziehungen. Dies umfasst regelmäßige Leistungsreviews, Benchmarking zwischen den Anbietern und die Anpassung der Volumenverteilung bei Bedarf.

Tacto Intelligence
Vereint tiefes Einkaufswissen mit den leistungsstärksten KI-Agenten für einen starken Einkauf.
Wichtige KPIs für Multiple Sourcing
Die Erfolgsmessung von Multiple Sourcing erfordert spezifische Kennzahlen, die sowohl Effizienz als auch Risikominimierung abbilden.
Lieferantenperformance-Metriken
Zentrale Leistungsindikatoren bewerten die Qualität der Lieferantenbeziehungen und ermöglichen objektive Vergleiche zwischen den Anbietern.
- Liefertreue und Termineinhaltung pro Lieferant
- Qualitätsrate und Reklamationsquote
- Preisabweichungen und Kostentransparenz
Risiko- und Diversifikationskennzahlen
Diese Metriken messen den Erfolg der Risikostreuung und die Stabilität der Lieferantenbasis. Der Herfindahl-Index beispielsweise quantifiziert die Konzentration des Beschaffungsvolumens.
Effizienz- und Kostenkennzahlen
Multiple Sourcing muss trotz höherer Komplexität wirtschaftlich vorteilhaft sein. Relevante KPIs umfassen Gesamtbeschaffungskosten, Transaktionskosten pro Lieferant und Cost Avoidance durch Risikominimierung.
Prozessrisiken und Gegenmaßnahmen in Multiple Sourcing
Trotz seiner Vorteile birgt Multiple Sourcing spezifische Herausforderungen, die proaktiv adressiert werden müssen.
Erhöhte Komplexität und Koordinationsaufwand
Die Verwaltung mehrerer Lieferantenbeziehungen erfordert zusätzliche Ressourcen und kann zu Ineffizienzen führen. Klare Prozesse und digitale Tools sind essentiell für erfolgreiches Management.
- Höhere Transaktionskosten durch multiple Schnittstellen
- Komplexere Qualitätssicherung und -kontrolle
- Aufwendigere Vertragsgestaltung und -verwaltung
Verlust von Skaleneffekten
Die Aufteilung des Volumens kann zu reduzierten Skaleneffekten und höheren Einstandspreisen führen. Eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse ist daher unerlässlich.
Informationssicherheit und Vertraulichkeit
Die Zusammenarbeit mit mehreren Lieferanten erhöht das Risiko von Informationslecks. Robuste Vertraulichkeitsvereinbarungen und Compliance-Richtlinien sind erforderlich, um sensible Unternehmensdaten zu schützen.
Praxisbeispiel
Ein Automobilhersteller implementiert Multiple Sourcing für kritische Elektronikkomponenten. Das Unternehmen teilt sein Jahresvolumen von 10 Millionen Euro auf drei qualifizierte Lieferanten auf: 50% an den Hauptlieferanten, 30% an einen regionalen Partner und 20% an einen innovativen Technologieanbieter. Diese Strategie reduziert Lieferrisiken erheblich, als der Hauptlieferant aufgrund eines Brandes temporär ausfällt.
- Kontinuierliche Produktion durch sofortige Volumenumverteilung
- Benchmarking führt zu 8% Kosteneinsparung im Folgejahr
- Verbesserte Innovationskraft durch Technologiepartner
Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen
Multiple Sourcing entwickelt sich kontinuierlich weiter und wird durch neue Technologien und Marktanforderungen geprägt.
Digitalisierung und KI-Unterstützung
Moderne Technologien revolutionieren das Management multipler Lieferantenbeziehungen. KI im Einkauf ermöglicht automatisierte Lieferantenbewertungen und optimierte Volumenallokation basierend auf Echtzeitdaten.
- Predictive Analytics für Lieferantenperformance
- Automatisierte Risikofrüherkennung
- Dynamische Preisoptimierung zwischen Lieferanten
Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien
Umwelt- und Sozialstandards gewinnen bei der Lieferantenauswahl zunehmend an Bedeutung. Multiple Sourcing ermöglicht es, verschiedene Nachhaltigkeitsansätze zu testen und zu vergleichen.
Regionale Diversifikation und Nearshoring
Geopolitische Unsicherheiten verstärken den Trend zu geografisch diversifizierten Lieferantenportfolios. Nearshoring wird als Ergänzung zu globalen Sourcing-Strategien immer wichtiger.
Fazit
Multiple Sourcing ist eine bewährte Beschaffungsstrategie, die Unternehmen dabei unterstützt, Lieferrisiken zu minimieren und die Verhandlungsposition zu stärken. Trotz höherer Komplexität und Koordinationsaufwand überwiegen die Vorteile bei kritischen Materialien und volatilen Märkten. Der Erfolg hängt von systematischer Lieferantenauswahl, kontinuierlichem Performance-Management und dem Einsatz digitaler Tools ab. Moderne Technologien wie KI erleichtern zunehmend das Management multipler Lieferantenbeziehungen und machen diese Strategie noch attraktiver.
FAQ
Was unterscheidet Multiple Sourcing von Dual Sourcing?
Multiple Sourcing umfasst die Nutzung von zwei oder mehr Lieferanten, während Dual Sourcing sich explizit auf genau zwei Anbieter beschränkt. Multiple Sourcing bietet größere Flexibilität, erfordert aber auch mehr Koordinationsaufwand.
Wann ist Multiple Sourcing besonders sinnvoll?
Diese Strategie eignet sich besonders bei kritischen Materialien, volatilen Märkten und hohen Beschaffungsvolumen. Auch bei strategisch wichtigen Komponenten oder bei Lieferanten in politisch instabilen Regionen ist Multiple Sourcing empfehlenswert.
Wie bestimmt man die optimale Anzahl von Lieferanten?
Die ideale Lieferantenanzahl hängt von Faktoren wie Marktgröße, Komplexität der Produkte und verfügbaren Ressourcen ab. Typischerweise bewegt sich die Anzahl zwischen zwei und fünf Lieferanten, um Effizienz und Risikominimierung zu balancieren.
Welche Kosten entstehen durch Multiple Sourcing?
Zusätzliche Kosten umfassen höhere Transaktionskosten, erweiterte Qualitätsprüfungen und intensiveres Lieferantenmanagement. Diese müssen gegen die Vorteile der Risikominimierung und verbesserten Verhandlungsposition abgewogen werden.

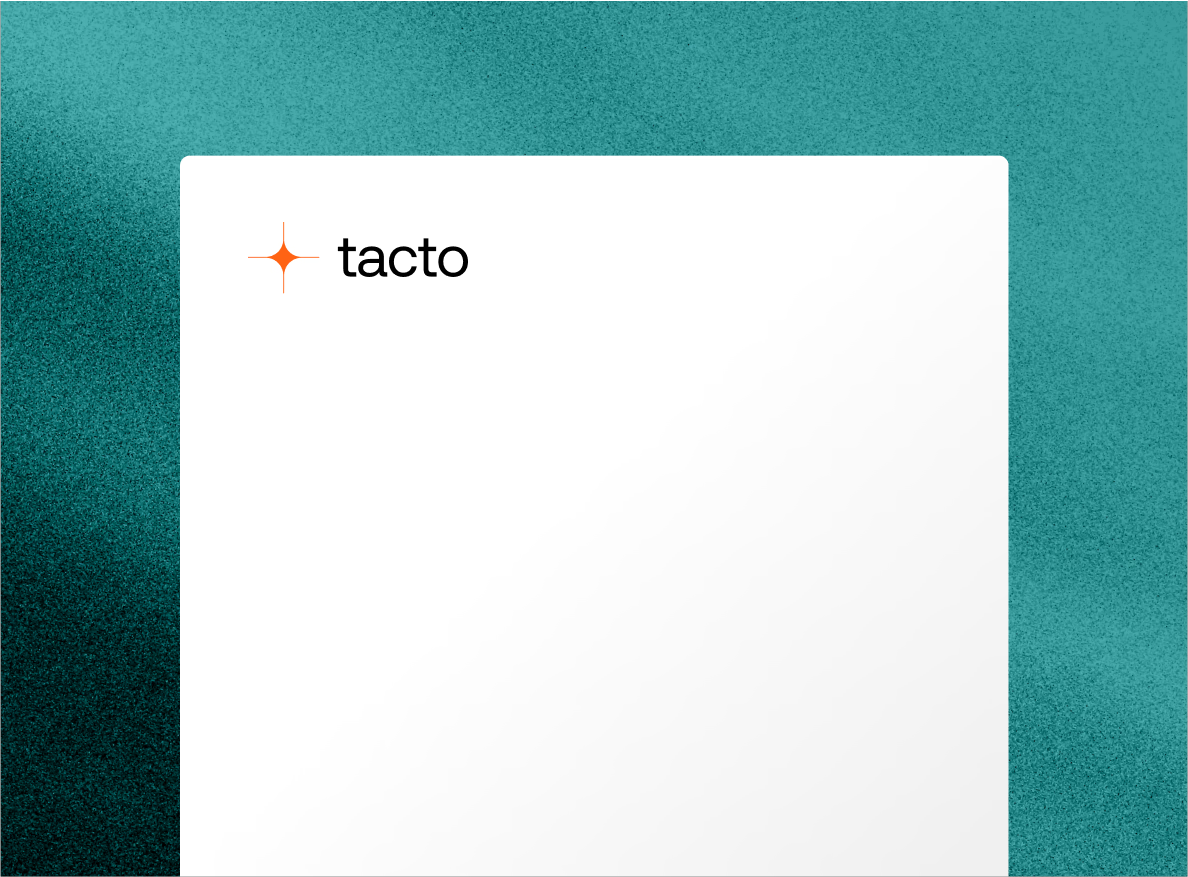
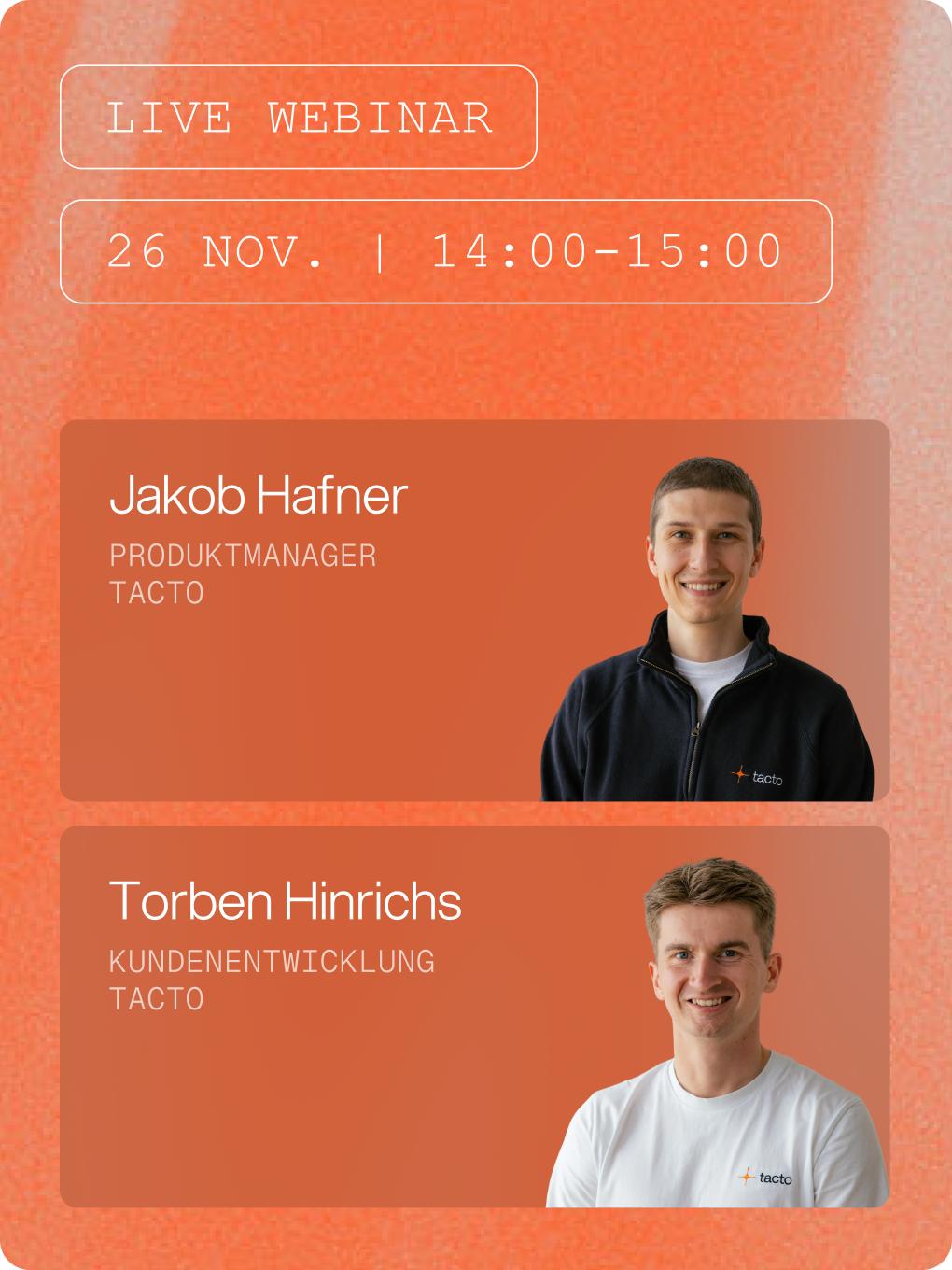
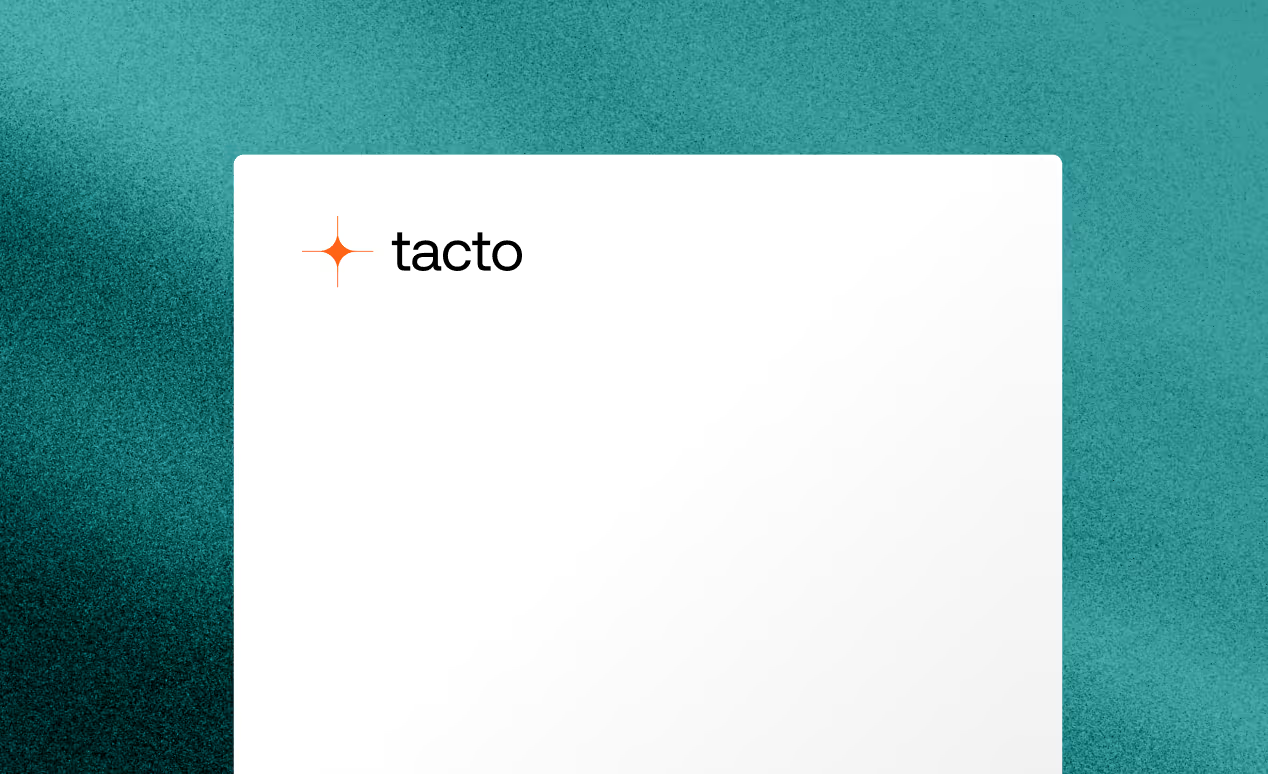


.png)
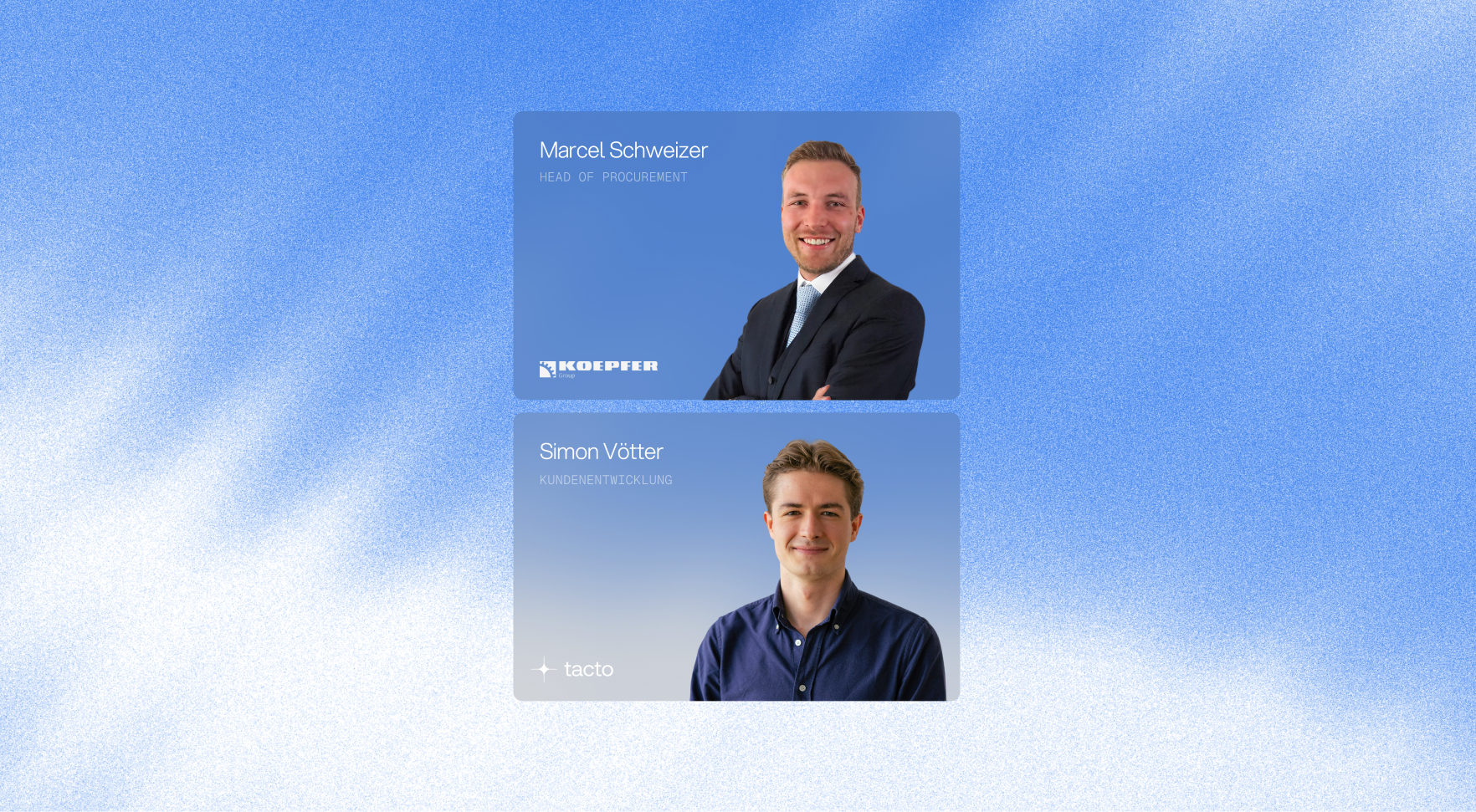


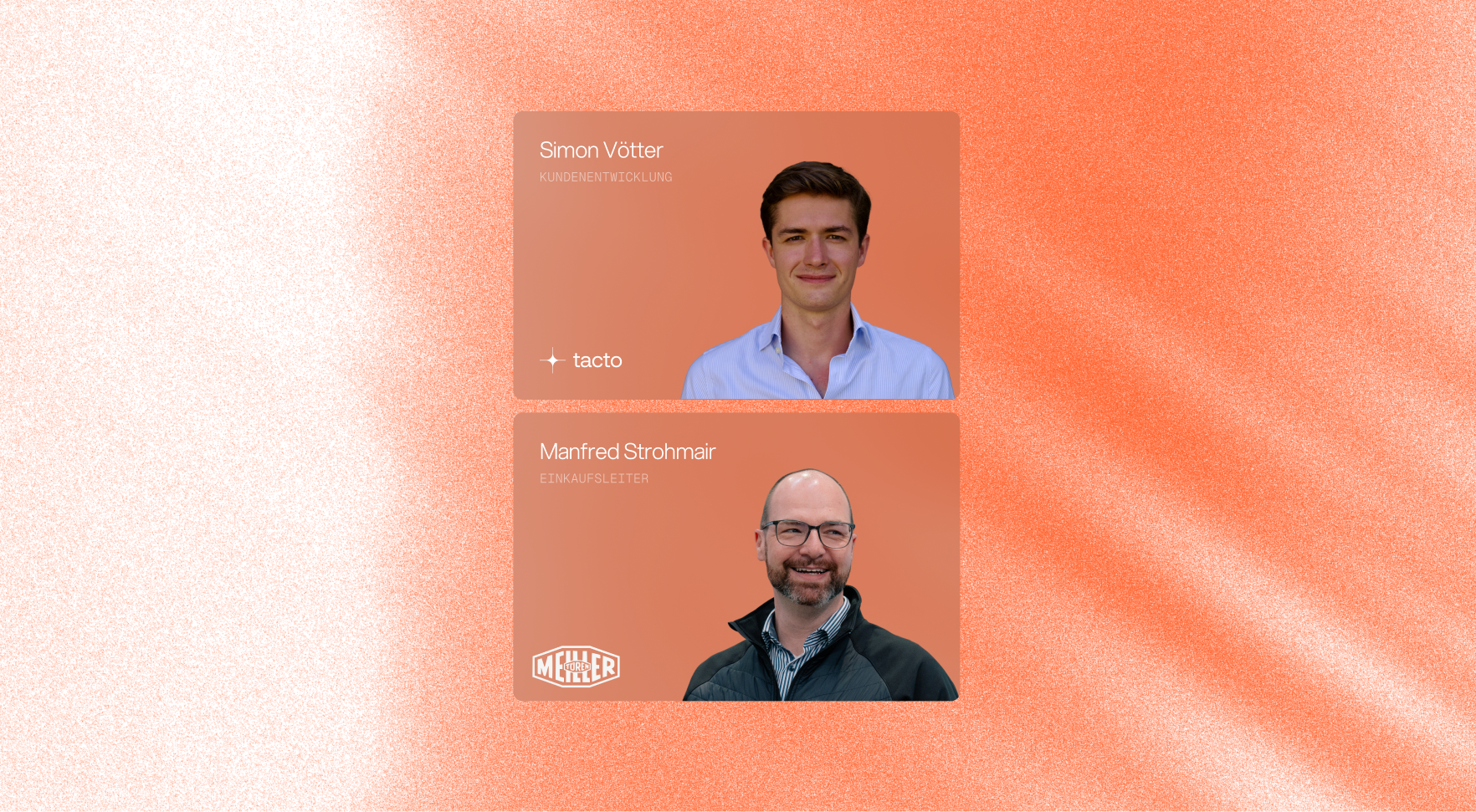
.png)
.png)
.png)
